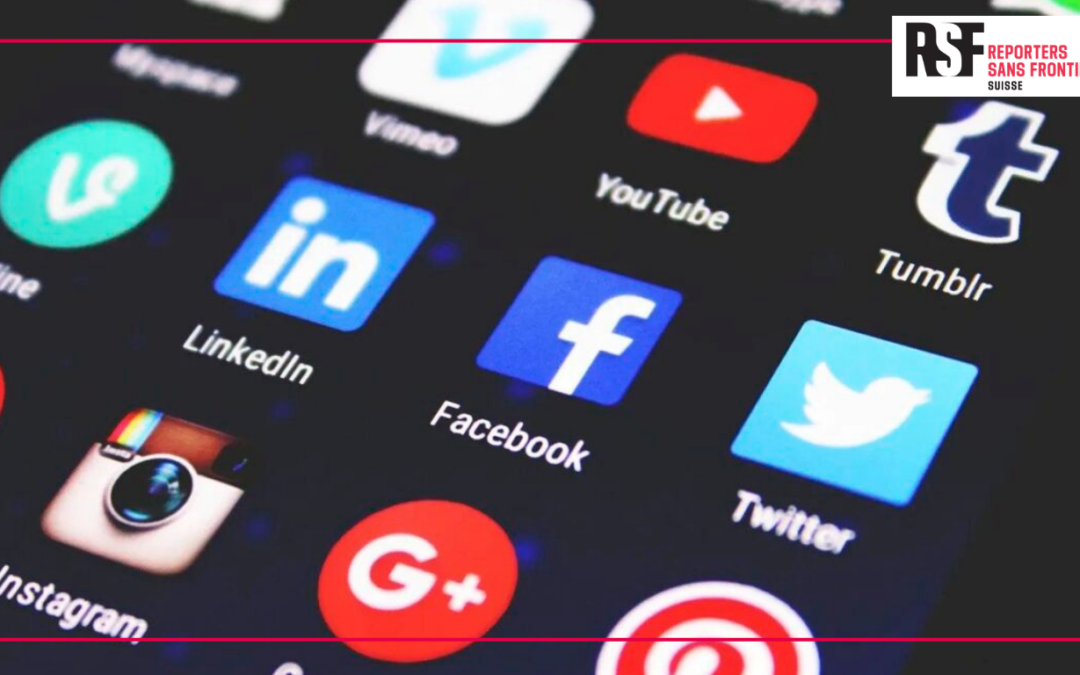Seit drei Jahren wird in der EU eine Verordnung zur sogenannten Chatkontrolle vehement diskutiert. Mit dem Gesetz solle die Verbreitung von Darstellungen sexueller Gewalt an Kindern bekämpft werden, so die Befürworter. Gleichzeitig würde eine solche Verordnung bei vielen Messenger- und Kommunikations-Dienstleistern die End-zu-End-Verschlüsselung aufbrechen. Das hätte schwerwiegende Folgen für den Datenschutz und für die Pressefreiheit in Europa. Und würde wohl auch die Schweiz betreffen.
Die EU-Verordnung, die sich gegen die Verbreitung von Darstellungen sexuellen Kindesmissbrauchs richten soll, wird seit langem kontrovers diskutiert. Nun hat Dänemark, das von Juli bis Dezember 2025 die Präsidentschaft des EU-Rats innehat, das Thema erneut auf die Tagesordnung gesetzt. Und ein wichtiges EU-Land, Deutschland, will diese Woche festlegen, ob es dem Vorschlag zustimmt oder nicht.
Die Vorlage sieht vor, dass Messenger wie WhatsApp, Signal, Telegram oder auch der Schweizer Anbieter Threema dazu verpflichtet werden sollen, alle Inhalte, noch bevor sie verschlüsselt werden, ohne jeden Verdacht automatisiert zu durchsuchen. Dazu müssten sie eine eigene Scanning-Software in ihre Apps einbauen. Darum spricht man bei der Vorlage auch von Chatkontrolle. Noch muss der EU-Rat bzw. die Innenminister der EU über das Geschäft befinden, doch nach zahlreichen Diskussionen stellen sich nur noch wenige Länder klar gegen die Vorlage. Die restlichen Länder befürworten den Vorschlag Dänemarks oder beraten noch darüber. Würde Deutschland der Verordnung nun zustimmen, hätte das eine Signalwirkung für den Rest des Kontinents und könnte dem umstrittenen Gesetz den Weg ebnen.
«Der Vorschlag der dänischen Ratspräsidentschaft, anlasslos die gesamte private Kommunikation zu durchleuchten, hätte schwerwiegende Folgen für die Pressefreiheit. Dies würde End-zu-End-verschlüsselte Kommunikation aushebeln und damit den Quellenschutz untergraben. Informantinnen und Whistleblower könnten sich dann nicht mehr sicher sein, dass ihre Informationen geschützt sind, und werden im Zweifel lieber schweigen. Wir fordern die Bundesregierung dazu auf, den Vorschlag abzulehnen und sich für die Sicherheit und Vertraulichkeit digitaler Kommunikation einzusetzen.»
Anja Osterhaus
Geschäftsführerin von Reporter ohne Grenzen Deutschland
Nicht effektiv, unverhältnismässig & grundrechtswidrig
Die Chatkontrolle würde massiv in die Privatsphäre und in die digitale Sicherheit aller eingreifen. Der aktuelle dänische Ratsentwurf bedroht sichere, verschlüsselte Kommunikation in ihrer Ganzheit. Zahlreiche Gutachten und Stellungnahmen von Sachverständigen haben festgestellt, dass die vorgeschlagenen Massnahmen ihr Ziel – die Verbreitung von Kindesmissbrauchsmaterial einzudämmen – nicht effektiv oder verhältnismässig erreichen würden. Hingegen weisen zivilgesellschaftliche Organisationen, Wissenschaftlerinnen und Experten aus der gesamten EU, darunter auch Forscher der EPFL in Lausanne, sowie Gutachten der wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestages, des Europäischen Parlaments und des Rates der EU darauf hin, dass die Massnahmen unvereinbar mit verbrieften Grundrechten sind.
Gefährlicher Präzedenzfall mit Folgen auch für die Schweiz
Der Bundesrat sprach sich im September 2024 zwar gegen eine allfällige Einführung einer vergleichbaren Chatkontrolle in der Schweiz aus. Dennoch hätte ein solches EU-Gesetz direkte Auswirkungen auf die Schweiz. «Schweizer Dienste, die in der EU ihre Dienstleistungen anbieten, sowie Internetnutzende in der Schweiz (könnten) von den (…) vorgesehenen Massnahmen betroffen sein», schrieb die Regierung damals in einem Bericht. Die genauen Auswirkungen liessen sich aber aufgrund der Diskussionen innerhalb der EU noch nicht abschliessend beurteilen.
«Die EMRK sowie die Bundesverfassung garantieren das Recht auf den Schutz der Privatsphäre. Eine Kriminalitätsbekämpfung, wie sie die Verordnung zur Chatkontrolle auf EU-Ebene vorsieht, würde – trotz dem hehren Ziel der Bekämpfung von sexuellem Missbrauch an Kindern – diesen Grundrechten klar widersprechen. Sollte die Schweiz eine ähnliche Regelung diskutieren, dann müsste dies zwingend unter Wahrung der Privatsphäre sowie der Meinungs- und Pressefreiheit geschehen.»
Valentin Rubin
Policy & Advocacy Manager RSF Schweiz
Fest steht aber: Einmal etablierte Überwachungsinfrastrukturen wecken Begehrlichkeiten für die Ausweitung ihres Einsatzes für andere Zwecke. Und ausgerechnet die EU würde mit dieser Verordnung ein fatales Signal setzen und autokratischen Staaten die Grundlage für eigene Überwachungsmassnahmen liefern.
Messenger-Dienste, die an ihrer End-zu-End-Kommunikation festhalten wollen, sind ebenfalls alarmiert: Meredith Whittacker, die Chefin der Signal-App, hat bereits gewarnt, dass Signal den europäischen Markt im Zweifelsfall verlassen müsse, wenn die Chatkontrolle eingeführt wird. Auch WhatsApp und Threema haben sich klar gegen das Vorhaben positioniert. Threema kommunizierte im Frühling in einer Mitteilung: «In einer gesunden Demokratie kontrollieren die Bürger die Regierung – Massenüberwachung ist die Umkehrung dieses demokratischen Grundsatzes.»